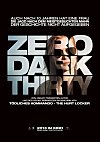Filmkritik: "Zero Dark Thirty"
Geschrieben am Donnerstag 31 Januar 2013 um 22:34 von Roland Freist
![]()
Die Nacht der Jägerin
Es gibt eine Szene in diesem Film, in der der Chef der CIA, gespielt von James Gandolfini, sich in der Kantine zu seiner Agentin Maya (Jessica Chastain) an den Tisch setzt. Er ist immer noch nicht hundertprozentig überzeugt, dass sie tatsächlich das Versteck von Osama bin Laden gefunden hat, und will ihr noch etwas auf den Zahn fühlen. Wie lange sie denn schon bei der CIA sei, fragt er sie. Zwölf Jahre, ist die Antwort. "Und was haben Sie vorher gemacht?" "Nichts. Die Agency hat mich direkt von der Highschool rekrutiert." Das ist eine der wenigen Szenen in "Zero Dark Thirty", in denen man zumindest ahnt, was in der Hauptperson dieses Films vorgeht. Denn von diesen zwölf Jahren hat Maya mindestens acht, wahrscheinlich jedoch mehr, ausschließlich mit der Suche nach bin Laden verbracht. Immer wieder wurde sie durch Rückschläge, aber auch durch Hindernisse in der eigenen Behörde aufgehalten, und musste sich gegen zweifelnde Kollegen und sogar gegen ihre Vorgesetzten durchsetzen, um die Spur zu bin Laden weiterhin verfolgen zu können. Außerhalb dieses Lebens auf der Jagd existiert Maya praktisch nicht.
Der Film beginnt, mit was auch sonst, mit den Anschlägen vom 11. September 2001. Regisseurin Kathryn Bigelow ("Blue Steel", "The Hurt Locker") verzichtet auf die Bilder von den Flugzeugen und den brennenden Türmen und spielt vor dem Hintergrund einer schwarzen Leinwand lediglich einen Zusammenschnitt von Telefongesprächen ab, die die Eingeschlossenen im World Trade Center mit ihren Angehörigen und den Rettungsdiensten führten.
Danach springt der Film ins Jahr 2003 und stellt uns Maya vor. Sie wurde als Verstärkung für die CIA-Agenten vor Ort in die amerikanische Botschaft nach Pakistan geschickt. In einer rund 20minütigen Sequenz sieht man sie als Zeugin bei der Folterung von Gefangenen. Die Männer werden bedroht, geschlagen, gedemütigt, mit Waterboarding und Schlafentzug gequält. In den USA haben diese Szenen eine Diskussion ausgelöst, ob "Zero Dark Thirty" die Folter rechtfertige oder sogar gutheiße. Doch das ist Unsinn. Es ist eine Qual, diese Szenen anzusehen. Im Unterschied zur Fernsehserie "24", in der Jack Bauer Folter genauso selbstverständlich einsetzte wie seinen Revolver, werden hier nicht nur die Schmerzen der Opfer spürbar, sondern auch das Unbehagen der Folterer. Auch Maya kann einige Male kaum noch hinsehen. Doch als es darum geht, von den Gefangenen Informationen zu bekommen, verfolgt sie ohne zu zögern die Linie ihrer folternden Kollegen.
Wir erfahren von Maya nicht mehr, als dass sie Osama bin Laden jagt, mit ihrer ganzen Energie und einem unbändigen Willen. Maya ist vermutlich eine Psychopathin: Sie zeigt kein gesteigertes Interesse daran, mit anderen auszugehen, die Männer in ihrer Umgebung nimmt sie nicht wahr. Sie sieht nicht fern, hört keine Musik, legt keinen Wert auf besondere Kleidung. Man hat dem Film den Vorwurf gemacht, dass seine Hauptfigur blass bleibt, weil sie nur selten etwas von sich preisgibt und keine Spur eines Zweifels zeigt. Doch das ist genau die Tragik – Maya definiert sich ausschließlich durch die Jagd auf Osama bin Laden. In der Schlussszene sieht man sie im Flugzeug sitzen, allein, und an ihrem Blick kann man ablesen, dass sie spürt, wie sie sich nach Abschluss der Jagd als Person quasi auflöst.
Jessica Chastain ("The Tree of Life", "Take Shelter") ist eine der großen, aufstrebenden Schauspielerinnen unserer Zeit. Für "Zero Dark Thirty" hat sie bereits einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einem Filmdrama bekommen, und die Chancen stehen gut, dass man ihr auch den Oscar überreichen wird. Sie gehört zu den Menschen, die eine Rolle scheinbar ganz einfach verkörpern können, ohne groß spielen zu müssen, sie sind einfach die Figur, die man ihnen gegeben hat. Das ist große Schauspielkunst und im Falle von Jessica Chastain umso bewundernswerter, wenn man sich erinnert, dass sie mit der gleichen Selbstverständlichkeit die überdrehte Celia Foote in "The Help" zum Leben erweckt hat.
"Zero Dark Thirty" hat einige Längen, einige Szenen hätte man deutlich kürzen können. Doch der Film wird nie langweilig. Er hat eine klar angelegte Struktur – aus dem Durcheinander der ersten Monate nach den Anschlägen, mit Tausenden von Hinweisen und Informationen, schält sich nach und nach eine Spur heraus, bis es zum Schluss in Abbottabad gegen das Endmonster geht. Doch mehr noch als von der Jagd auf bin Laden handelt er von der Frau, die ihn gefunden hat. Nach allem was man weiß, ist die echte Agentin, die das Vorbild für die Maya im Film abgab, anschließend irgendwo in der Bürokratie der CIA verschwunden.
"Zero Dark Thirty" in der IMDB
Der deutsche Trailer: