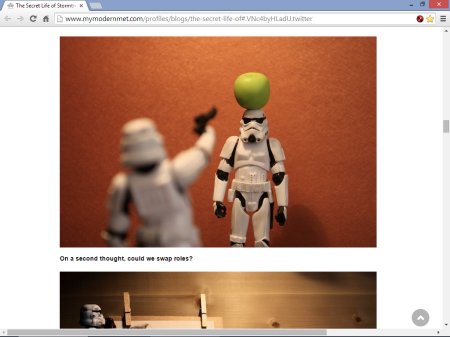Filmkritik: "American Sniper"
Geschrieben am Donnerstag 26 Februar 2015 um 23:38 von Roland Freist
![]()
Schüsse aus dem Hinterhalt
Wenn man sich an die Filme über den zweiten Irakkrieg erinnert, Streifen wie "Green Zone", "The Hurt Locker" oder "Im Tal von Elah", so kommen einem vor allem Szenen von Straßenkämpfen in den Sinn. Während der erste Krieg im Irak einige Jahre zuvor in erster Linie mit Bilder von brennenden Ölquellen und über der Wüste aufsteigenden, schwarzen Rauchsäulen verbunden ist, hat das Hollywood-Kino den zweiten Feldzug weitgehend auf die Straßenkämpfe in Bagdad und Falludscha reduziert, auf die Hinterhalte und Sprengfallen, die Autobomben und Selbstmord-Attentäter, die der Hightech- und Elitesoldaten-Armee der USA immer wieder schwere Schläge verpassten.
In "American Sniper" geht es um die wahre Geschichte eines ganz besonderen Elitesoldaten, eines Navy Seal, der zum Scharfschützen ausgebildet wurde. Chris Kyle (Bradley Cooper) kommt aus Texas und gibt einen Seal wie aus dem Bilderbuch ab, groß, ruhig, mit einem unglaublichen Panzer aus Muskeln und ohne den geringsten Zweifel an seiner oder der Mission der USA. Er hatte sich freiwillig zum Militärdienst gemeldet, nachdem er von den Anschlägen durch al-Qaida auf die amerikanischen Botschaften in Daressalam und Nairobi gehört hatte. Wenige Wochen nach den Anschlägen vom 11. September fliegt er zu seinem ersten Einsatz in den Irak.
Dort ist er überaus erfolgreich. Sein Job ist es in der Regel, die vorrückenden amerikanischen Truppen zu schützen. Dazu sucht er sich möglichst unbemerkt einen erhöhten Standort und erschießt von dort aus alle Personen, die sich den Soldaten nähern, um sie mit Gewehren, Panzerfäusten oder Granaten zu attackieren. Während seiner vier Einsätze im Irak, das entspricht insgesamt mehr als 1000 Tagen, bringt er es auf mehr als 160 bestätigte Tötungen. Gleich sein erstes Opfer ist ein Kind, ein kleiner Junge, der von einer Frau mit einer Granate losgeschickt wurde, um einen amerikanischen Panzer in die Luft zu jagen. Aus anderen Kritiken zu diesem Film erfahre ich, dass Regisseur Clint Eastwood an dieser wie auch an einigen anderen Stellen von der literarischen Vorlage, den Erinnerungen des echten Chris Kyle abgewichen ist, denn tatsächlich war es wohl eine Frau, die die Granate trug und die Kyle daraufhin erschoss.
Wie der Film die Geschichte von Chris Kyle inszeniert, das ist meisterhaft. Die Bilder folgen dem Gemütszustand des Snipers: Während zu Anfang alles noch ruhig, unaufgeregt und unter Kontrolle ist, spürt man sowohl bei Kyle wie auch bei der Darstellung der Geschehnisse zum Schluss hin die zunehmende Anspannung und das Chaos, das sich breit macht. Bei dem Seal äußert sich das in Bluthochdruck und unkontrollierten Wutanfällen, wenn er nach Hause kommt, die Bilder des Krieges werden immer unübersichtlicher und münden schließlich in einem gigantischen Sandsturm, in dem die amerikanischen Soldaten beinahe verloren gehen.
Bradley Cooper spielt das ganz ausgezeichnet. Der Mann, den die meisten Zuschauer vermutlich aus der Buddy-Komödie "Hangover" kennen, wurde in der Vergangenheit bereits zwei Mal für einen Oscar nominiert (für "American Hustle" und "Silver Linings") und bekam für "American Sniper" seine dritte Nominierung. Sein Chris Kyle ist ein bedächtiger, eher wortkarger Mann, der mit zunehmender Dauer des Krieges immer dünnhäutiger und empfindlicher wird. Er ist verheiratet mit Taya, gespielt von Sienna Miller, die man in dieser Rolle kaum wiedererkennt. Zum Schluss seiner Zeit im Irak nehmen ihn die Geschehnisse so mit, dass er sie mitten aus dem Kampfgetümmel per Satellitentelefon anruft.
Ist "American Sniper" ein Antikriegsfilm? Nein, mit Sicherheit nicht. Er verherrlicht den Krieg aber auch nicht oder ist außergewöhnlich patriotisch. Es ist die Geschichte eines Soldaten. Und das ist dann leider auch der entscheidende Schwachpunkt. Denn der Chris Kyle dieses Films ist ein sehr langweiliger Charakter, einfach, geradlinig, ohne Ecken und Kanten. Kein Vergleich mit dem rätselhaften, scheinbar wahnsinnigen Sergeant William James aus "Hurt Locker" oder den innerlich verrohten GIs aus "Im Tal von Elah". Chris Kyle ist dagegen der Typ von Soldat, der gerne in Schulen geht, um bereits im Klassenzimmer Werbung für den Armeedienst zu machen, der Mr. Saubermann von nebenan. Da hilft auch der eindrucksvolle Vollbart nicht, den er sich im Irak wachsen lässt. So gut und teilweise auch rau der Film ansonsten gemacht ist, die glatte, einfach gestrickte Figur seines Protagonisten bringt ihm ein dickes Minus ein.
Der deutsche Trailer: